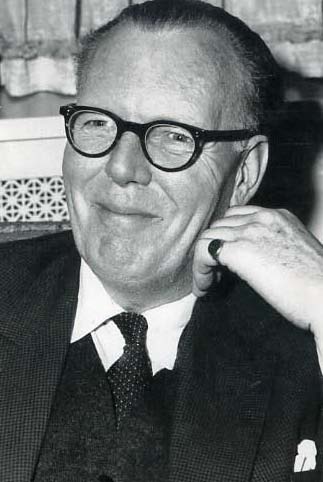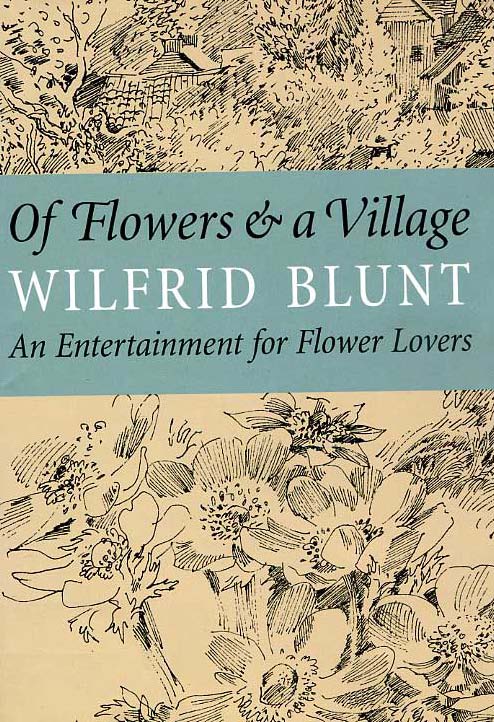Nicht nur die Pflanzen an sich sind spannend. Auch die Menschen, die sich für sie begeistern, sind von einer ganz besonderen Typologie.
Auf Englisch bezeichnet man sie als „Plantsmen“. Der Autor Duane Isely hat ihnen sein lesenswertes Buch „One hundred and one Botanists“ http://(https://www.amazon.de/One-Hundred-Botanists-Duane-Isely/dp/0813824982) gewidmet.
Er hat ihre Lebenslinien von Aristoteles (384- 322 a. Chr. n.) bis zu den Botanikern des 20. Jahrhundert in knappen Portraits skizziert.
Interessant sind auch die bisweilen kuriosen Umstände, mit denen Botaniker auf Forschungsreisen zu Tode kamen. Darüber kann man in der Artikel-Serie „How they died“ der renommierten botanischen Zeitschrift „Taxon“ lesen.(https://onlinelibrary.wiley.com/journal/19968175).